kann man nicht veLwechseRn
Ernst Jandl
von Andreas Butt-Weise
„Wer sagt, es gäbe kein links und rechts, kann kein Linker sein.“
Émile-Auguste Chartier
Der öffentliche Diskurs ist schon lange nach „rechts“ verschoben …
„Unter kultureller Identität versteht man das Zugehörigkeitsgefühl eines Individuums oder einer sozialen Gruppe zu einem bestimmten kulturellen Kollektiv.
Dies kann eine Gesellschaft, ein bestimmtes kulturelles Milieu oder auch eine Subkultur sein. Identität stiftend ist dabei die Vorstellung, sich von anderen Individuen oder Gruppen kulturell zu unterscheiden, das heißt in einer bestimmten Anzahl gesellschaftlich oder geschichtlich erworbener Aspekte wie Sprache, Religion, Nation, Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen oder in sonstigen Aspekten der Lebenswelt.
Die individuellen Weltanschauungen, die eine kulturelle Orientierung prägen, sind heterogen und können durchaus auch zueinander im Widerspruch stehen.“ /1/
„Das Neue wird das Alte sein!“
Es ist nicht zu vermeiden, dass wir uns dem Konflikt zuwenden, der zwischen einer „modernen“ Vorstellung von Gesellschaft und einem regressiven Bewusstsein besteht, das die Rückkehr zu „Volk“ und „Nation“ predigt, da dieser Konflikt aktueller denn je ist. Dieses Hochholen des Nationalen durch linke Retter der Vaterländer überlässt sich – bewusst oder unbewusst – dem Lob der Querfront. So scheint es, als ob die Hinwendung zur „Nation“ und zur „Heimat“ der traditionsgebundenen Linken einem inneren Bedürfnis nach Vaterland folgt. Davor ist man auch im linken Spektrum nicht gefeit, obwohl man über die theoretischen Mittel einer Überwindung verfügt, einer regressiven Vorstellung von einer „erträumten Gemeinschaft“ zu unterliegen. Hiermit werden berechtigte Affekte (Gefühle wie Wut und Liebe über den aktuellen Zustand der Welt) auf so abstrakte wie toxische Konstruktionen wie „Nation“ und „Volk“ gerichtet.
Für einige Linke sind Worte wie „Heimat“ und „Volk“ nicht harmlos klingende Codes, die lediglich den Widerspruch „triggern“, sondern sie sind, weil durch den Nationalsozialismus missbraucht, hochgradig toxisch und deshalb „tabu“. Wir sollten nicht glauben, dass sie Traumata auslösen, weil sie nicht nur in der Vergangenheit benutzt wurden, sondern in der Gegenwart von Rechtsextremisten zu Aus- und Abgrenzung benutzt werden.
So lange diese Begriffe, wie „Heimat“, „Volk“ und „Nation“ nicht dekonstruiert, kontextualisiert und mit neuen Inhalten gefüllt worden sind, kann ihre Verwendung nur ein „Vorwärts in die Vergangenheit“ bedeuten. Die – nicht ganz unbegründete – Sehnsucht nach „Gemeinschaft“, die sich in den Begriffen wie „Volk“ und „Heimat“ äußert, mündet ohne eine Neudefinition ihrer Inhalte und einer Abgrenzung von nationalen und völkischen Phantasien einer eigenen „Kulturseele“ in einem „Retrotopia“ / einer „Regressionsutopie“. /2/ Dieses Dilemma einer nicht klaren Abgrenzung sollte uns zu denken geben.
detoxify the word
Sprache als Aspekt kultureller Identität dient nicht nur der (temporären) Stabilisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern ist ebenfalls ein konstitutives Element für Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und kann als aktives Mittel verstanden werden, um Veränderungen des Sozialen voranzutreiben. Ihr ist somit – laut Judith Butler – ein genuin emanzipatorisches und kritisches Potential inhärent. Sprache ist ein nicht zu unterschätzendes „Werkzeug“, um Veränderungen im Alltäglichen hervorzubringen, Veränderungen deutlich zu machen und voranzubringen. Sprache ist ein wichtiges, weil konstitutives Element für gesellschaftliche Transformationen. Sie hat sowohl die Macht zu schmähen, auszugrenzen, zu verletzen – siehe „Hatespeech“ oder „Triggerwörter“ -, und kann auch als Werkzeug für sprachliche Umdeutungsprozesse genutzt werden, um das Soziale zu transformieren. Sprache kann dazu verwendet werden, Vorurteile zu bestätigen, als auch neue Ideen publik zu machen. Wir sollten uns dieser Chance auf Veränderung nicht durch überholte Verwendungskontexte berauben lassen.
Wir sollten diese Form des „Nationalstaats“ als ein Auslaufmodell verstehen, wenn der Weisheit letzter Schluss ausschließlich in den Traditionen gesucht und das „Nationale“ mit den nicht ganz unberüchtigten deutschen Tugenden wie Leistung, Fleiß und Anstrengung eng verknüpft ist. Diese deutschen bzw. preußisch-protestantischen Tugenden sind dann überkommene Werte und abzulehnen, wenn sie Tradition und Gemeinschaft nur im Gegensatz zu Autonomie und Selbstverwirklichung sehen. Es bliebe unbeachtet, dass Individualität und Selbstverwirklichung Grundvoraussetzung für ein kreatives, innovatives und modernes Leben ist.
Es bleibt unbestritten, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, „Gemeinschaft“, Sicherheit und Zusammenhalt, einem gewissem Grad an Stabilität und ein Leben in vertrauter Umgebung das Leben lebenswert macht. Dieses Bedürfnis muss nicht als ein ausschließlich wertkonservatives Bedürfnis gewertet werden. Das ist nur dann wertkonservativ, wenn Begriffe wie „Familie“, „Volk“, „Heimat“, „Vaterland“, „Nation“ etc. mit konservativen Werten verbunden werden. Dies sind Begriffe, deren Werte in unserer „offenen Gesellschaft“ schon seit einigen Jahrzehnten in Frage gestellt, relativiert und durch neue Begriffe und Vorstellungen ersetzt wurden.
Ab- und Ausgrenzung inklusive
Den Menschen, die sich in unserer Gesellschaft von der Politik ständig ignoriert fühlen und nicht mehr von den „kulturellen“, gesellschaftlichen und politischen Errungenschaften angesprochen fühlen – die “offene Gesellschaft” eher als „closed shop“ /3/ erleben – ihnen kann auch nicht mit einem nationalen „Wir-Gefühl“ geholfen sein. Dieses identitäre Angebot wird durchaus und das zu Recht mit sehr großer Skepsis gesehen, wurde doch dies „Wir-Gefühl“ historisch immer wieder missbraucht. Es schließt sich hiermit die Frage an, wie und in welchem Rahmen / auf welcher Ebene ist die Identifizierung mit dem „eigenen“ Land anders als eine Romantik des Nationalen möglich? Wie lässt sich das für eine Solidargemeinschaft notwendige „Wir-Gefühl“ herbeiführen, da es durchaus eine Quelle der Solidarität und des sozialen Miteinander ist, ohne nationalistisch und somit reaktionär zu sein?
Diese „polittheologischen“ Massentheorien, die das Einbezogensein in die Funktionsmasse des „Man““ oder des „Wir“ als notwendig voraussetzen, sind dann veraltet bzw. rückwärtsgewandt, wenn sie die Gefahr wissentlich ausblenden, dass wenn es keinen (notwendigen) Außenfeind mehr gibt, ein Innenfeind für den Erhalt der Nation herhalten muss. An dieser Stelle muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass laut Umfragen in allen westlichen Ländern 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung hohe Zuwanderung ablehnen und sich restriktivere Regeln wünschen. Diese Zahlen machen die offenkundige Verbreitung eines Ressentiments gegenüber allem Fremden sichtbar. Dieses Ressentiment kann in aller Deutlichkeit als das bezeichnet werden, was es ist: „Alltagsrassismus“. Die Sorge dieser „Alltagsrassismus“ könnte jederzeit, durch Fremdenhass und identitären Wahn befeuert, in „ethnischen Säuberungen“ und „Pogrome“ umschlagen, ist nicht von der Hand zu weisen. Wer diese Zustände des Fremdenhasses als soziale Notwehr rechtfertigt, hat ohne Wenn und Aber als Rassist zu gelten.
Wie ansonsten ist jemand zu bezeichnen, der seine „Zukunftsängste“, der seine Wut über die Ignoranz der Politik gegenüber seinen Lebensumständen, in Aggression gegenüber Anderen bzw. Fremden freien Lauf lässt? Oder Einen, der aus seinen gewalttätigen Angriffen auf Anders-denkende, -lebende, -aussehende und aus seiner Gefolgschaft zu Ideologen der „Neuen Rechten“ keinen Hehl macht?
Wer die rechten Ressentiments von AfD-Wählern – ca. 20% in unserer Gesellschaft – als berechtigten Ausdruck der Politik von Vergessenen darstellt, die nichts weiter erwarten, als dass ihre eigene Regierung sich in erster Linie um ihr Wohl kümmert, als was soll man diese Person bezeichnen? Ist dieser Anspruch auf ausschließliche Sorge um einen Teil der hiesigen Bevölkerung wirklich komplett fehlinterpretiert, wenn dieser Anspruch als „nationalsozial, gern auch mit der Endung -istisch“ /4/ missachtet wird? Zumindest ist diese Form der Sorge durchaus auch als eine Vorstellung des Staates als eine „völkische Schutzmacht“/5/ zu verstehen.
Wir versus die Anderen
Und ist es nicht so, dass, weil man dem alltäglichen „Nationalismus“ und seiner „vaterländischen Schollenkleberei“/6/ ihre systemsprengende Dynamik nehmen will, diesem ein Stück zu weit entgegenkommt? Indem dieses rechte Unmutskollektiv der AfD sich den chronisch Unzufriedenen, den systematisch Benachteiligten, den Bedürftigen und den Aufstiegsbehinderten andient, indem sie mit dem Geborgenheitsversprechen der wiedererstarkten Nation ein gutes Bauchgefühl – eine Form des Irrationalismus – zu vermitteln versucht? Ist das auch für eine Linke der richtige Weg, um die sich zu Recht beklagenden zunehmend schlechter Gestellten in unserem Land den Klauen der „Rattenfänger“ zu entreißen? Bietet ein „neuer“ Nationalismus Verbesserungen ihrer Lebenssituation? Wir sollten uns nicht von denen vor sich hertreiben lassen, die als die Stimme der „besorgten Bürger“ gelten wollen und mittler Weile den politischen Diskurs zu bestimmen scheinen.
„So landet man politisch schließlich nahe dort, wo die Gegenseite schon ist.“
Es gibt eine immer größere Zahl von Menschen in unserer Republik, die das „Eigene“ – das eigene Land und die eigene Lebensweise – durch alles „Fremde“ infrage gestellt empfinden. Hier stehen Begriffe wie „Heimat“ und „Nation“ hoch im Kurs. Sie sind jedoch nicht als eine Sehnsucht nach solidarischer „Gemeinschaft“ zu werten, sondern auch als ein Geborgenheitsverlangen, dass jede Offenheit gegenüber allem „Fremden“ als existenzgefährdend heraufbeschwört.
Mit Begriffen wie „Volk“ bzw. Mehrheitsgesellschaft wird eine Homogenität der Bevölkerung suggeriert, die es so nicht gibt. Mit dieser vorgeblichen Homogenität einer Mehrheitsgesellschaft und das sollten wir ausdrücklich festhalten, verweigert sich „Heimat“ denen, die in unserem Land ein „Zuhause“ gefunden haben oder auch denen, die zerrissen in 3. Generation weder hier, noch in den Herkunftsländern ihrer Eltern / Großeltern „beheimatet“ sein können. Oder es verunmöglicht denjenigen ein Zugehörigkeitsgefühl, die aus biographischen Gründen, sich immer auch – wenn auch nur ein wenig – nicht dazugehörig fühlen durften, wie z.B. Sinti und Roma. /7/ Aus- und Abgrenzung sind den Begriffen „Volk“ und „Heimat“ immanent: wie und wer sie definiert, definiert auch ihre Wirkung, d.h. wenn eine Mehrheit der Gesellschaft sich als „Gemeinschaft“ versteht, entwickelt sie ein Bild von sich, dass sich meist im Gegensatz zu Anderen zu einem gemeinsamen „Wir“ gestaltet.
Diesem „Verhängnis“ ist nur in der Suche nach kulturüberschreitenden Antworten entgegenzutreten: eine Renationalisierung, die die spätkapitalistische Konsumlawine aufhalten will, kann nur ein aufgeklärtes Nationalbewusstsein, Internationalität und Friedensmentalität vereinen wollen. Zu diesem aufgeklärten Nationalbewusstsein gehört das eindeutige Bekenntnis zum Grundgesetz, zu nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Wehret den Anfängen! Erinnern wir uns der Verbrechen, die im Namen unseres „Volkes“ in einem überbordenden „Wir-Gefühl“ begangen worden sind und übernehmen endlich Verantwortung!
Heterogene Kultur
Interessant an der Tatsache, dass unser heutiger „Kulturliberalismus“ (heterogene kulturelle Orientierung) aktuell von „linkskonservativen“ oder „linksorthodoxen“ bis „vulgärmarxistischen“ Gruppierungen in Frage gestellt wird, ist, dass er bisher hauptsächlich von konservativen, reaktionären, klerikalen Gruppierungen angefeindet wurde. Die Nichtakzeptanz der Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, Simultaneität und Multidimensionalität kultureller Äußerungen, ist und bleibt unverständlich. Der Versuch unsere vielschichtigen Ausprägungen von Identitäten einer „nationalen Identität“ oder einer Identität als Lohnabhängige zu unterwerfen, widerspricht der gegebenen Mehrschichtigkeit aller gesellschaftlichen Vorgänge und Sozialprozesse, die zum Ende der 1980er Jahre vom britischen Historiker Eric J. Hobsbawm methodisch konturiert und als „the multidimensionality of human beings in society“ bezeichnet wurde.
Diese Vorstellung der Vielschichtigkeit des Menschen und seiner multiplen Handlungsmöglichkeiten, die weit über die weberianische Eindimensionalität hinausgeht, der zufolge das Streben nach Einkommen die einzige und letzte Triebfeder allen wirtschaftlichen Handelns ist /8/, sollte für einen emanzipatorischen Geist Grundvoraussetzung sein.
Selbst Marx kritisierte diese Einteilung in seiner Kritik des Gothaer Programms (1875) scharf, als er sich gegen die ausschließliche Betrachtung des Arbeiters „nur“ als Arbeiter und das Übersehen ihrer Unterschiede als Menschen verurteilte: „aber die ungleichen Individuen (und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleiche wären) sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten Seite fasst, z.B. im gegebenen Fall sie nur als Arbeiter betrachtet und weiter nichts in ihnen sieht, von allem anderen absieht.“ /9/
Das was hier für das Individuum gilt, ist auch für die Gesellschaft als Ganzes gültig: es gibt nicht nur die eine Identität, sondern mehrere. In der sowohl offen als auch verdeckt auftretenden „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ und „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen“ werden die Mehrschichtigkeit aller Sozialprozesse deutlich: es gibt nicht nur eine Kultur, sondern eine Kultur, die sich aus vielen unterschiedlichen Kulturen zusammensetzt.
Leitkultur
„Sie sagen, jetzt, wo so viele Flüchtlinge zu uns kommen, sei nicht der richtige Zeitpunkt, um sie auf die Einhaltung unserer Werte hinzuweisen. Doch! Wir sollten darauf bestehen. Wir sind mitverantwortlich für das Leid, das die Flüchtlinge ertragen müssen, und deshalb sollen wir ihnen helfen. Aber zugleich haben wir in Europa das Recht, den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung, die Rechte der Homosexuellen, die individuelle Verantwortung und all dies eben nicht zu vergessen. In diesem Sinne bin ich für eine Leitkultur.“ /10/
Gehen wir davon aus, dass in den letzten 75 Jahren in der Bundesrepublik eine gewisse Mehrheitskultur bzw. eine Leitkultur entstanden ist, die eine Identifikation mit unserem Land möglich macht, dann sind diese Bestandteile der kulturellen Moderne verpflichtet: sie heißen: Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft“. Diesen Werten muss im öffentlichen Raum Vorrang vor religiösen Normen eingeräumt werden. (vgl. Bassam Tibi: Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft, 1998) Diese Werte stehen in einem klaren Gegensatz zu Begriffen wie „Westliche Leitkultur“ oder „Christliche Leitkultur“, die als gestrig und als gefährlich gelten sollten. Auch steht diese Vorstellung eines Kulturpluralismus mit Wertekonsens im Widerspruch zu einem werterelativierenden Multikulturalismus und gegen die damit gerechtfertigten Parallelgesellschaften.
Unsere kulturelle Identität besteht aus einer nicht endenden diskursiven Konstruktion des „Eigenen“. „Ja, es gibt teilweise und für Momente ein „Wir“, das aber ständig neu geschaffen werden muss.“ /11/ Sie wird in einem Gegensatz zu einem wirklichen oder bloß vorgestellten „Anderen“ immer wieder neu definiert. Weil dieser Vorgang stark von Gefühlen geprägt ist, da das Eigene sich in einem Sicherheits-, Geborgenheits- und Heimatgefühl vermittelt, bleibt die Form rationaler Gestaltung unbedingt notwendig. Aktuell ist es das Gefühl der Unterdrückung, Ausbeutung, Ausgrenzung oder Diskriminierung, das sich in der Sehnsucht nach einer kollektiven Identität selbst zu ermächtigen sucht. Während sich vor allem in traditionalen Gesellschaften die kulturelle Identität in einer unhinterfragten Identifikation mit der bestehenden Ordnung ausdrückt, äußert sich gegenwärtig die Nichtwahrnehmung und Verunsicherung in Abneigung und sogar Hass gegenüber dem „Anderen“ oder dem „Fremden“.
Wer nicht bereit ist, die Haltung der „eigenen“ Gruppe zu verinnerlichen, die Normen und Werte der „Gemeinschaft“ „auf seine eigenen Schultern zu laden“ und sich damit gegenüber den anderen Gemeinschaftsmitgliedern verpflichtet zu fühlen, dem bleibt als Alternative nur die Los- bzw. Ablösung. Die „Befreiung“ des Individuums von dieser „kulturellen Identität“, in das es durch Sozialisation bzw. Enkulturation eingebunden war, ist seine einzige Chance, sich selbst zu entdecken. Das Opponieren, der Ungehorsam, die Rebellion, die „große Weigerung“ etc. gegenüber allen Konzepten kultureller Identität, egal ob nationaler, regionaler, ethnischer, sprachlicher, religiöser, sexueller oder ästhetischer, führt zu einer „Neuformulierung“ derselben. Es ist Grundvoraussetzung für jede kulturelle Innovation.
Parallelkulturen
Parallelkultur oder Parallelgesellschaft beschreibt als ein soziologischer Begriff die gesellschaftliche Selbstorganisation eines segregierten (abgespaltenen), sozialen Milieus. Es setzt eine Abschottung „von der Mehrheitsgesellschaft und die Befolgung eines alternativen Wertesystems“ voraus. Es entspricht dabei nicht den Regeln und Moralvorstellungen der (konservativ geprägten) Mehrheitsgesellschaft und wird deshalb von dieser mitunter abgelehnt. /12/ Die Beschreibung einer Desintegration, die hier im Wesentlichen immer gerne auf arabische Clans angewendet wird, überschneidet sich in seinem Bedeutungsinhalt mit Gegenkultur und Subkultur. So sind es Lebensstile, die diesen Subkulturen zugeordnet werden, wie die der Hippies, Punks, Rocker oder Mods. Gothic-Szene, Rapper und viele Facetten der Popkultur. Aber auch das, was wir bis dato unter E- und U-Kultur zu verstehen hatten, bildet verschiedene Parallelkulturen aus. Der Grad der Abweichung erstreckt sich von kleinen Modifikationen bis zu ausdrücklichen Gegenpositionen.
So können wir konstatieren, dass soziale sowie kulturelle Systeme in unterschiedliche Subsysteme ausdifferenziert sind, die sich wiederum in ihren unterschiedlichsten Normen und Werten ausdifferenzieren. Spielen (gesellschaftliche) Visionen und Utopievorstellungen eine Rolle, die sich als „Gegenkultur“ durch das Infragestellen von primären Werten und Normen der Mehrheitskultur verstanden wissen will, sprechen wir von einer „Gegenkultur“, aus der heraus sich eine Gegenöffentlichkeit bilden kann.
Nimmt man es ganz genau, so kann man auch soziale Klassen als Parallelgesellschaften bzw. Subkulturen verstehen. Dies ist insofern plausibel, als das die Angehörigen einer Klasse (z. B. Bauern, Adel, Bourgeoisie, Proletariat) eigene Werte, Normen und Verhaltensweisen entwickelt haben. So folgen die Mitglieder der unterschiedlichen Klassen auch unterschiedlichsten kulturellen Gepflogenheiten.
Diese Polyphonie ist Kennzeichen einer kulturellen Parallelgesellschaft. Unsere Gesellschaft ist (und das war sie schon immer) eine hybride Gesellschaft: sie war nie rein, war nie identisch mit einem „reinen“ Volk, und bestand nie aus einem homogenen Gewebe! Die Vorstellung einer homogenen „Leitkultur“ ist in Gänze irreführend. Sie widerspricht der Geschichte unserer Region und unseres Landes. Sie war schon mal als Gedanke grundverkehrt in seiner Umsetzung (1933-1945) und kann es auch nur bleiben!
Im Gegenteil, wäre die Frage nach der Differenz und Abgrenzung zu der bestehenden Vorstellung von Kultur nicht notwendige Voraussetzung für das Entstehen neuer kultureller Ausdrucksformen? In der Kunst gibt es verschiedene Aspekte der Negation: So wird eine Kunstrichtung durch eine andere abgelöst und damit negiert. Neue Methoden treten an die Stelle der alten. So verneinte z.B. L’art pour l’art die Zweckgebundenheit von Kunst.
„Rasse“ und kulturelle Identität
Wurde bisher mit der biologischen „Rasse“ und den ihr inhärenten psychischen, mentalen, sozialen Eigenschaften und des essentiell „Anderen“ argumentiert, womit sie als Bedrohung für den (als Organismus gedachten) „Volkskörper“ dargestellt werden konnte, so wird heute die „fremde Kultur“ bzw. kulturelle „Differenz“ betont, die die „homogene Einheit“, die „kulturelle Identität“, das System der gesellschaftlichen Ordnung der Einheimischen bedrohe. /13/ (vgl. Taguieff 1998, 236)
Laut Etienne Balibar gibt es nun eine neue Form des Rassismus – den „Neo-Rassismus“ – als ein Rassismus ohne Rassen – der nicht mehr die biologische Vererbung zum Thema hat, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen zum beherrschenden Thema gemacht hat. Dieser von ihm beschriebene „Neo-Rassismus“ geht davon aus, dass, weil die „verschiedenen Lebensweisen“ miteinander nicht vereinbar sind, eine „Grenzverwischung“ zwischen unterschiedlichen Kulturen deshalb nur als schädlich wahrgenommen wird. Diese unversöhnliche Einstellung steht für ihn deshalb für einen „differentialistischen Rassismus“. /14/
Wenn wir diesem „Paradigmenwechsel“ vom biologischen zum kulturellen (Neo-) Rassismus in der Suche nach einer „authentisch kulturellen Identität“ folgen, schreiben wir die Differenz von „Wir“ und die „Anderen“ auf fatale Weise fest. Die Forderung nach „nationaler“ und „kultureller“ Identität – bei der nicht selten das „völkische“ mitgedacht wird – ist im Wesentlichen eine Abgrenzung nach außen. Ein homogenisierender Kulturbegriff führt ohne Wenn und Aber in die Abgrenzung von „Wir“- und „Sie“-Gruppen nach nicht rational nachvollziehbarer Wir-Identität bzw. Sie-Identifizierung. Die hierfür herbeizitierten Kriterien wie „Abstammung, Religion, Sprache, Geschichte, Werte und Sitten“ /15/ ersetzen mühelos den Rassebegriff von einst. Diese Vorstellung von Kultur mündet ohne Umstand genau in diesem „kulturalistischen Rassismus“.
Wenn wir uns als „links“ verstehen, können wir die heutige Diversität an kulturellen „Subkulturen“ im Grunde nicht als eine oberflächliche Fülle verstehen. Was in den 60iger Jahren des letzten Jahrhunderts noch als ein „Triumph der repressiven Egalität“/16/, eine Uniformität mit sanften Mitteln, die die Erzeugnisse der Kulturindustrie einander zum Verwechseln ähnlich macht, verstanden wissen wollte, erkennen wir heute ihre emanzipatorischen Möglichkeiten. Auch wenn wir weiterhin kritisch anmerken müssen, wie Kultur zur Ware geworden ist, so erkennen wir doch in ihrer vielfältigen Ausprägung nicht nur eine „Reproduktion des Immergleichen“/17/, sondern ihre neue Horizonte aufbrechende Wirkung.
„Ich, das ist ein Anderer“
Wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, können wir feststellen, dass sie nicht homogen, sondern vielfältig und divers ist. Wollen wir nicht der Homogenität das Wort reden, weil sie eine Fantasie von gestern ist, können wir feststellen, der kulturelle Ausdruck in unserer Gesellschaft gehört der Mischung, der Vielfältigkeit, den Differenzen.
„Es ist einer Kultur eigen, dass sie nicht mit sich selber identisch ist. (…) Es gibt keine Kultur und keine kulturelle Identität ohne diese Differenz mit sich selbst.“ /18/ Jacques Derrida, Das andere Kap, Frft.a.M. 1992, S.12f.
Laut Julia Kristeva sind wir auch als Individuen nicht einfach mit uns identisch. Wir sind keineswegs vollendet, sondern wir bleiben uns als Menschen durch unsere „Abgründe“ selbst fremd. Es ist diese Differenz zu uns selbst, die sich in Spannungen in und mit der Gesellschaft deutlich werden. Unsere Beziehung zu Fremden ist eine Beziehung zu uns selbst. „Das Fremde ist in uns selbst. Und wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir gegen unser Unbewusstes – dieses „Uneigene“ unseres nicht möglichen „Eigenen“.“ /19/ Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, 1990, S. 208/209
Die Fremdheit wohnt uns selbst inne. Das Verhältnis zum anderen Fremden hat im Verhältnis zum eigenen Fremden seine Grundlage. Je nachdem, wie weit die Selbstbeziehung gelingt oder nicht, wird auch die Fremdbeziehung gelingen oder nicht. Gewiss kommt der Fremde in der Realität von außen auf uns zu. Aber unser Verhältnis zu ihm kann nicht von außen, sondern muss von innen begriffen werden. „Das Fremde ist in mir, also sind wir alle Fremde.“ /20/Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, 1990, S. 209
Das Fremde ist in uns selbst!
So einfach – hier ich, da die Anderen – so einfach geht es nicht! So homogen – wie diese Polarität suggeriert – sind weder wir noch die anderen. Wir alle sind gemischt, vielfältig, gespalten … Wir sind alle miteinander auf dem Weg zu uns selbst und im besten Fall zu einander. Da wir unser Selbstbild nicht ohne andere Selbstbilder entwickeln können, ist die soziale Umwelt für eine Selbsterkenntnis eminent wichtig. Unsere Identitätsbildung erwächst aus dem Umgang mit anderen.
Wir blieben Autarkisten oder Monaden, würde unser „Ich“ und unsere „Identität“ nicht in sozialen Prozessen entstehen. Doch ist unsere Identität nicht einfach nur ein vielfältiges Patchwork, sondern durch starke Hierarchisierungen, Gebote und Verbote sowie durch massive Verschattungen und Verdrängungen bestimmt. So gehören Bewertungen (Favorisierungen und Verwerfungen), Spaltungen und Abspaltungen, Vergötzungen und Verdrängungen zu unserer Konstitution. In Folge gibt es zwischen uns und uns selbst ebenso viele Unterschiede wie zwischen uns und den Anderen. All die Widersprüche etc. in uns spielen in die „Eigen-Fremd-Differenz“ mit hinein. In der Begegnung mit dem „Anderen“ besteht die Gefahr, dass wir etwas von uns abstoßen, was wir in uns selber tragen, aber nicht zulassen wollen oder wollten. Was wir mit aller Macht verdrängen müssen, externalisieren wir, um es mit viel Wut und Hass von uns wegstoßen zu können. Das was uns am Fremden „unheimlich“ erscheint, ist „etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist.“ /21/ Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, 1990,S.201 / Freud: Das Unheimliche , in: GW, Bd. 12, S.231
Unser Selbstverhältnis ist die Matrix unseres Fremdverhältnisses
Warum ist genau dieser Diskurs über das „Eigene“ und das „Fremde“ so notwendig? Weil es deutlich machen könnte, dass wir es in der Frage nach „Kultur und Identität“ mit einem vermeidbaren „Debakel“ zu tun haben: die Erfahrung des Fremden kann unsere inneren „Demarkationslinien“ verrücken! Es ist ein anderes Selbstverständnis: eines der Empathie, der Sensibilität und des Hineinhörens in uns Selbst! Es könnte ein Menschenbild eröffnen, das sich nicht an „äußeren“ Merkmalen bzw. „äußerlichen“ Werten (Leistung, Fleiß, Anstrengung, Pflicht & Schuldigkeit) orientiert, sondern an „inneren“ (Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Intelligenz, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Entschlossenheit, Verantwortung).
Sollte man in seiner Entwicklung einen inneren Riss, eine Erschütterung erfahren haben, die einem das Gewohnte zumindest einen Moment fraglich gemacht hat, macht es leichter sich gegenüber anderen und fremden Erfahrungen zu öffnen. Straucheln, Unsicherheit und Erschütterung verweisen auf die Bewusstseinswerdung und die Anerkennung von Fremdheit. Diese Einsicht in die eigene Fremdheit eröffnet uns die Bedingung für eine „negative“ Antwort auf Verwurzelungsansprüche, die an uns herangetragen werden.
Haben wir unsere eigene Fremdheit in uns selbst aufgespürt, dann ist es mit dem Unterschied von Eigen und Fremd vorbei. Dann ist die Fremdheit das universale Schicksal aller Menschen als „Kulturwesen“, ein Schicksal, das uns alle verbindet! Dann haben wir das entdeckt, was uns mit den „Anderen“ verbindet. „Die einzige Chance der Linken besteht in einer permanenten Erneuerung des Geistes von 1968: man müsste (mit diesem Bewusstsein) alle heterogenen Bewegungen zusammenbringen …“ /22/ Überlassen wir die „Festwurzler“ ihrem „nationalen Hochmut“ und reichen unseren „Geschwistern im Geiste“ die Hand! In Solidarität nur gemeinsam!
/6/ Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, in: Sämtliche Werke, 1980, Seite 180f.
/9/ Karl Marx: Kritik , in KM/FE – Werke, Bd.19, 1973, S. 21
/11/ Didier Eribon: Protest ist immer radikal …; in: Der Spiegel, 12.06.2021, S.112
/13/ Taguieff, Pierre-André. Die Metamorphosen des Rassismus und die Krise des Antirassismus, Bielefeld 1998, S. 236
/14/ vgl,: Étienne Balibar: Rasse, Klasse, Nation; Hamburg 1990, S.23-38
/15/ders.
/16/Adorno & Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frft.a.M.1977, S.15
/17/ Adorno & Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frft.a.M.1977, S.120
/18/ Jacques Derrida, Das andere Kap, Frft.a.M. 1992, S.12f.
/19/ Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, 1990, S. 208/209
/20/ dito., S. 209
/21/ dito., S.201 / Freud: Das Unheimliche, in: GW, Bd. 12, S.231
/22/ Didier Eribon: Protest ist immer radikal …; in: Der Spiegel, 12.06.2021, S.112



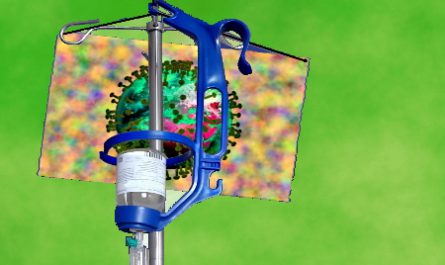

Es ist enttäuschend so einen Beitrag in dieser Bewegung zu lesen. Das ist eindeutige Ideologie der Linksliberalen und Lifestyle-Linken. Wenigsten in dieser Bewegung hätte ich diese Ideologie nicht vermutet. Der Artikel steht z.B. Sarah Wagenknechts Buch „Die Selbstgerechten“ voll entgegen. Insofern würde mich sehr interessieren ob diese Sichtweise in der Bewegung „Aufstehen“ üblich ist. Wenn ja wäre eine Bewegung im Sinne Sarah Wagenknechts neuen Buches wichtig um den Lifestyle-Linken mit ihrem Geschwurbel um Ersatzprobleme nicht das Feld zu überlassen.